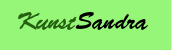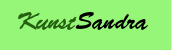Pferd
Technik: Bronze.
Signiert.
Nummeriert: 39 / 500.-
Stempel: Venturi Arte.
Höhe: 210 mm.
Gewicht: 750 Gramm.
Titel: Steigendes Pferd.
Objekt-Nr. 3178
Preis: 220.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Sitzender Akt
Technik: Bronze.
Höhe: 90mm.
Gewicht: 2750 Gramm.
Titel: Sitzender Akt.
Objekt-Nr. 3057
Preis: 150.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Meyring Carl Ulrich
Carl Ulrich Meyring
13.05.1946 in Hallenberg - 07.10.2016.
Studium: Schüler von Ernst Oldenburg, Prof. Röttgers, Prof. Beck.
Technik: Bronze.
Titel: Umarmung.
Signiert.
Nummeriert: 3/15.
Datiert: 1982.
Höhe Figur: 385mm.
Gewicht Figur: 9400 Gramm.
Der Künstler studierte an den Universitäten Würzburg und Bonn Naturwissenschaften, Kunstgeschichte und Pharmazie. Er war Schüler von Ernst Oldenburg, Prof. Röttgers, Prof. Beck und entschied sich 1977 gegen die Laufbahn in der Apotheke seines Vaters für die Kunst.
Im Laufe der Jahre entwickelte Meyring unterschiedliche, charakteristische Ausdrucksformen, die von der rein abstrakten Malerei über Collagen bis hin zu Arbeiten mit abstrahierenden und verfremdenden Elementen führen.
Die seit seiner Einladung 1999 nach Weimar nahe Buchenwald entstandenen politischen Gemälden und Textbilder sind Zeichen eines couragierten, sehr mutigen, historischen und gesellschaftskritischen Bewusstseins, was ihm Stärke durch Schaden schenkte.
Seine Ideenfülle ist ungewöhnlich. Malerei und Bildhauerei behandelt er gleichwertig und erarbeitet seine Werke vorwiegend aus einem Thema heraus. Seine Eigenwilligkeit ließ - bis auf eine Ausnahme - keine Auftragsarbeiten zu. Diese Ausnahme blieb die für eine jüdische Galerie in Straßburg 1982 entworfene - Menora -
Seit 2001 verwendet Meyring für seine Skulpturen erstmals auch Corten-Stahl, ein Material, was sich durch Oxydation verstärkt und mit seinen vielfältigen Verfärbungen bezaubert.
Seine Gemälde, Grafiken, Bronzeobjekte und großen Stahlskulpturen finden in öffentlichen und privaten Sammlungen weit über Europa hinaus Freude, Gefallen und Bewunderung.
Objekt-Nr. 3002
Preis: 1350.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Paris Roland
Roland Paris
18. März 1894 in Wien - 04. Mai 1945 in Swinemünde.
Studium: Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule Weimar.
Technik: Bronze - Urform.
Titel: Lio.
Höhe Figur: 290mm.
Gewicht Figur: 2500 Gramm.
Gewicht Sockel: 2500 Gramm.
Abmessung Sockel: 100mm * 100mm * 100mm.
Roland Paris besuchte ab 1905 das Großherzogliche Realgymnasium in Weimar.
Ab 1909 war er Schüler an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstgewerbeschule Weimar.
Hier erhielt er 1912 den zweiten und dritten Preis sowie 25 Mark bei einem Wettbewerb zur Gestaltung von Emblemen für Studentenverbindungen, die er noch für zwei bis drei weitere Jahre fertigte. Einige dieser Arbeiten zeigten den Einfluss des Jugendstils, andere beinhalteten mehr moderne Ansätze.
1912 belegte Paris einen Bildhauerkurs an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule Weimar bei dem Bildhauer Gottlieb Elster.
Danach reiste er nach München, wo er bei mehreren Bildhauern Praktika aufnahm.
1913 kehrte er zurück an die Kunstschule Weimar und studierte Malerei bei Walther Klemm.
Objekt-Nr. 3001
Preis: 1500.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Schinzel Erwin A.
Erwin A. Schinzel
24. Oktober 1919 in Jägerndorf - 2018 in Karlsruhe.
Studium: Meisterschüler bei Prof. R. Scheibe und Prof. Arno Breker
Technik: Bronze.
Titel: Frauenakt mit Tuch - "Sommerwind".
Höhe: 435mm.
Signiert.
Nummeriert: 6 / 450.
Gewicht: 2800 Gramm.
Gießerstempel: H & G.
Artes - Edition 1981 / Werk-Nr. 272.
1919 Geboren in Jägerndorf / Sudetenland.
1939 - 1944 Besuch der Akademie der Bildenden Künste in Berlin mit kriegsbedingten Unterbrechungen.
Meisterschüler bei Prof. R. Scheibe und Prof. Arno Breker.
Ab 1945 Freischaffender Künstler in Augsburg.
1991 Übersiedlung nach Waldbronn.
Würdigungen:
"Pygmalion Medaille" Kunststiftung der Deutschen Wirtschaft.
Professur der internationalen Akademie der Bildenden und Schönen Künste zu Altenburg.
"Goldener Ehrenring für Bildende Kunst" Deutsches Kulturwerk Europäischen Geistes.
Staatliche Ankäufe.
Kunstsammlungen Augsburg.
Privatsammlungen des Spanischen Königshauses.
Objekt-Nr. 2947
Preis: 2250.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Zeitner Herbert
Herbert Zeitner
12. Juni 1900 in Coburg - 14. Oktober 1988 in Lüneburg.
Studium: Staatliche Zeichenakademie in Hanau.
Technik: Bronze.
Höhe Bronze: 100mm.
Höhe Sockel: 20mm.
Signiert.
Entstehungszeit ca: 1920.
Titel: Mädchen.
Abgebildet im Buch. Dort in Silber ausgeführt.
Er schuf Vasen, Kannen, Kelche, Schalen, Kreuze, Tafelgeschirr, die ganze Bandbreite des Schmucks sowie Arbeiten für Städte und öffentliche Institutionen. Für seine Arbeit wurde Herbert Zeitner unter anderem mit dem Niedersächsischen Staatspreis für das gestaltende Handwerk (1966), dem Bayerischen Staatspreis (1974) und dem Lüneburg-Preis (1981) geehrt. Die Gold- und Silberschmiede-Arbeiten, die Zeitner in den Jahren zwischen 1918 und 1933 anfertigte sind durch so verschiedene Stilrichtungen wie Jugendstil, Art Déco und Bauhaus geprägt, während das spätere Schaffen der 1960er und 1970er Jahre durch eine zunehmende Abstraktion gekennzeichnet ist.
Seine Ausbildung absolvierte Herbert Zeitner von 1914 bis 1921 als Stipendiat an der Staatlichen Zeichenakademie in Hanau, die in dieser Zeit von Hugo Leven geleitet wurde. Zu seinen Lehrern gehörte Reinhold Ewald. 1924 bestand Zeitner seine Meisterprüfung als Goldschmied in Hanau. Noch im selben Jahr wurde er durch den Architekten, Designer und Grafiker Bruno Paul zum Lehrer für künstlerische Metallgestaltung an den Vereinigten Staatsschulen für angewandte Kunst in Berlin-Charlottenburg berufen. Zu den Gold- und Silberschmiedearbeiten, die Zeitner in den 1920er Jahren anfertigte gehört auch eine lange Halskette aus Korallen und Porzellan, die die Filmschauspielerin Brigitte Helm in Fritz Langs Stummfilmklassiker „Metropolis“ trug. 1930 wurde Zeitner Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Goldschmiedekunst in Berlin.
Zwischen 1933 und 1945 fertigte Zeitner in Berlin auch Schmuck für die Repräsentanten des Nationalsozialismus; 1935 wurde er zum außerordentlichen Professor ernannt und 1939 Leiter eines Meisterateliers für Goldschmiede an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin. Nach 1945 distanzierte sich Zeitner zwar vom Nationalsozialismus, unstrittig ist jedoch, dass er zwischen 1933 und 1945 von seinen Arbeiten für die Machthaber des NS-Regimes profitierte.
Nach Kriegsende, 1945, verließ Zeitner Berlin mit einem Hausboot und ließ sich in Lüneburg nieder. In den ersten Jahren nach dem Krieg arbeitete er auf dem Hausboot, von 1954 bis 1959 führte er dann als Goldschmiedemeister eine Werkstatt mit Gesellen im alten Kaufhaus in Lüneburg. 1955 wurde Zeitner Vorsitzender der Arbeitsgruppe Kunsthandwerk Lüneburger Heide in der Arbeitsgemeinschaft Kunsthandwerk Niedersachsen. Zu den Gold- und Silberschmiedearbeiten, die Zeitner in den 1960er Jahren anfertigte gehört auch die Kette des Lüneburger Oberbürgermeisters, die 1966 entstand. 1969 fertigte er für die Hamburger Volksbühne den Ehrenpreis Silberne Maske an.
Im Sommer 2010 erinnerten zwei Ausstellungen, im Deutschen Goldschmiedehaus in Hanau und in der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade in Lüneburg an das Lebenswerk Herbert Zeitners.
Objekt-Nr. 2878
Preis: 850.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Chiparus Demétre
Demétre Chiparus, nach.
16. September 1886 in Dorohoi, Königreich Rumänien - 22. Januar 1947 in Paris.
Studium: École des Beaux-Arts, Frankreich.
Technik: Bronze.
Höhe Bronze: 420mm.
Höhe Sockel: 30mm.
Gewicht: 3400 Gramm.
Signiert auf dem Sockel.
Nummeriert: A7242.
Titel: Tänzerin.
Demétre Haralamb Chiparus war ein rumänischer Bildhauer und Keramiker. Mit der Formgestaltung seiner chryselephantinen Skulpturen zählt er zu den bedeutendsten Künstlern des Art déco. Seine Arbeiten stellen meist Tänzerinnen der Ballets Russes dar, als Sinnbild für die moderne Frau.
Chiparus’ Chryselephantinen besitzen durch ihre elegante, aus Bronze, Emaille und Farbe gearbeitete Kleidung, die starke Stilisierung der aus Elfenbein geformten Gesichter und ihre lange, schlanke Erscheinung einen hohen dekorativen Effekt. Sie zählen zu den bestgehandelten Skulpturen der Art-Déco-Periode. Die meisten von ihnen entstanden zwischen 1914 und 1933.
Dumitru wurde als Sohn von Haralamb und Saveta; geboren. 1909 ging er nach Italien, wo er bei dem italienischen Bildhauer Raffaello Romanelli studierte. 1912 zog er nach Paris, wo er die École des Beaux-Arts besuchte. Dort erhielt er Unterricht bei Antonin Mercie und Jean Boucher. Hier perfektionierte Chiparus seine Chryselephantin-Technik, bei der er Bronze und Elfenbein kombinierte und die bronzenen Elemente meist durch Kaltmalerei oder Emaillieren dekorierte. Sein besonderes Augenmerk galt dabei weniger der Qualität der Elfenbeinschnitzerei als dem juwelenartigen Dekor der Bronzeoberflächen, die seiner Arbeit ein eigenständiges Erscheinungsbild gab.
Seine erste Serie bestand aus Kinderskulpturen, die dem Stil des Realismus sehr nahe kamen. Sie wurde 1914 auf dem Pariser Salon der Société des Artistes Indépendants gezeigt, wo Chiparus von 1914 bis 1928 durchgehend ausstellte; darunter 1923 den Speerwerfer und 1928 die Ta-Keo-Tänzerin. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden Chiparus’ Arbeiten von den Gießereien Edmond Etling & Cie und Les Neveux de Jules Lehmann sowie Arthur Goldscheider ausgeführt, jedoch verschlechterten sich darauf die Lebensumstände für Bildhauer in Frankreich im Zuge der deutschen Besatzung des Landes dramatisch.
Seit den frühen 1940ern produzierte Chiparus Tierskulpturen im Art-Déco-Stil, arbeitete aber nicht mehr primär für den Verkauf, sondern aus eigenem innerem Antrieb. Auf seinen letzten Ausstellungen im Pariser Salon zeigte er 1942 die Gips-Skulptur Eisbär und Büffel sowie 1943 seinen Eisbären aus Marmor und einen Pelikan aus Gips.
Objekt-Nr. 2877
Preis: 850.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
unsigniert
Technik: Bronze.
Höhe: 430mm.
Breite: 340mm.
Tiefe: 70mm.
Gewicht: 21400 Gramm.
Titel: Abstrakt.
Objekt-Nr. 2869
Preis: 750 Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Soriano Catherine
Catherine Soriano
Technik: Bronze
Monogrammiert.
Nummeriert: 1 / 8.
Höhe Figur: 200mm.
Höhe Sockel: 20mm.
Gewicht: 2300 Gramm.
Titel: Akt.
Objekt-Nr. 2839
Preis: 650.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Richter Axel
Axel Richter
03.04.1960 in Oldenburg.
Studium: Bildhauerstudium an der
Kunstschule Munzingen / Freiburg i. Br.
Technik: Bronze.
Höhe: 155mm.
Breite: 72mm.
Tiefe: 80mm.
Gewicht: 1250 Gramm.
Monogrammiert: AR.
Datiert: 1993.
Titel: Akt.
1986 Bildhauerstudium an der freien Kunstschule Munzingen bei Freiburg / Breisgau.
1990 Diplom, Beginn der selbständigen Arbeit in Hamburg.
1991 - 2009 Arbeit als Ziseleur in der Bildgießerei M. Wittkamp in Elmenhorst / Lauenburg.
Seit 1993 Ausstellungen, Privataufträge, Kunst am Bau.
Seit 1994 Bildhauer- und Plastizierkurse für Laien u. Berufsgruppen.
Seit 2000 Initiator und Leiter des Kunst-Hauses am Schüberg Ev.-luth. Kirchenkreis Hamburg - Ost.
Objekt-Nr. 2764
Preis: 650.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Geipel Baldur
Baldur Geipel
24. Dezember 1933 in Reichenbach im Vogtland.
Studium: Akademie der Bildenden Künste München.
Technik: Bronze.
Abmessung Bronze: 20cm * 18,5cm * 14,5cm.
Abmessung Sockel: 121cm * 18cm * 18cm.
Gesamtgewicht: 11300 Gramm.
Entstanden: 2003.
Titel: Durchbrochene Wand.
Baldur Geipel wurde als Sohn von Kurt und Helene Geipel, geb. Glauche geboren. Er besuchte von 1948 bis 1952 die Fachschule in Oberammergau in der Klasse bei Hans Schwaighofer (1920–2000). Nach bestandener Gesellenprüfung 1952 arbeitete er 1952/53 in der Werkstatt von Richard Lang (1920–2006) ebenfalls in Oberammergau. Von 1953 bis 1959 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste München als Meisterschüler bei Professor Josef Henselmann und erwarb 1959 das Abschlussdiplom.
Seit 1959 ist er selbständig tätig. 1961 war er Stipendant des DAAD in Frankreich. Von 1978 bis 1996 unterrichtete Baldur Geipel als Fachlehrer für Bildhauerei an der Fachschule für Schreiner und Holzbildhauer in Garmisch-Partenkirchen. Seit 1997 arbeitet er als freischaffender Künstler in München und gestaltet in Bronze, Holz und Papier.
Baldur Geipel unternahm zahlreiche Studienreisen nach Spanien, Frankreich, Holland, Ägypten, Griechenland, Italien, Türkei, und nach New York.
Objekt-Nr. 2762
Preis: 600.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Jones Allen
Allen Jones
01. September 1937 in Southampton.
Shokking by Allen Jones, aus der Serie "les beaux Arts".
Allen Jones' Vater war aus Wales, während der Wirtschaftskrise versuchte er in Southampton Arbeit auf den Docks zu finden. Als Allen Jones drei Jahre alt war, zog die Familie in den Westen von London. Jones studierte von 1955 bis 1960 am Hornsey College of Art und am Royal College of Art in London, wo er Studienkollege von R. B. Kitaj und David Hockney war. Ab 1964 lebte er für zwei Jahre in New York. In der Folge übernahm er zahlreiche Lehraufträge an Kunsthochschulen, unter anderem auch in Hamburg und Berlin. Er war Teilnehmer der documenta III in Kassel im Jahr 1964 und auch auf der 4. documenta im Jahr 1968 als Künstler vertreten, wo er Perfect Match präsentierte.
1986 wurde er als Vollmitglied in die Royal Academy of Arts gewählt. Allen Jones lebt heute in London.
Objekt-Nr. 2723
Preis: 250 Euro
|
|
|
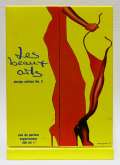 |
|
 |
 |
 |