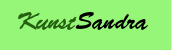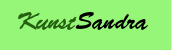1.1.
Stevan Vukmanovic
14.08.1924 in Belgrad - 06.01.1995 in Biberach.
Studium: Charles Crodel.
Technik: Öl / Leinwand.
Abmessung ohne Rahmen: 49cm * 59cm.
Abmessung mit Rahmen: 52cm * 62cm.
Signiert.
Bildtitel: Tänzerinnen im Moulin Rouge in Paris.
Rahmung: Rahmenleiste.
1955 - 61 Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München, Meisterschüler bei Prof. Charles Crodel.
1957 Stipendium vom Bayerischen Staat bzw. vom DAAD (Deutscher Akademie Austauschdienst).
Ausstellungen im Haus der Kunst München mit der Secession.
Objekt-Nr. 3170
Preis: 600.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Vukmanovic Stevan
Stevan Vukmanovic
14.08.1924 in Belgrad - 06.01.1995 in Biberach.
Studium: Charles Crodel.
Technik: Öl / Holz.
Abmessung ohne Rahmen: 59cm * 74cm.
Abmessung mit Rahmen: 63,5cm * 78,5cm.
Signiert.
Bildtitel: Haidhausen - München.
Rahmung: Rahmenleiste.
1955 - 61 Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München, Meisterschüler bei Prof. Charles Crodel.
1957 Stipendium vom Bayerischen Staat bzw. vom DAAD (Deutscher Akademie Austauschdienst).
Ausstellungen im Haus der Kunst München mit der Secession.
Objekt-Nr. 3169
Preis: 600.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Höfer Amelie
Amelie Höfer
Geboren: 13.03.1997
Studium: Gymnasium Neufahrn - Schauspielschule München.
Technik: Öl / Leinwand.
Abmessung ohne Rahmen: 50cm * 40cm.
Abmessung mit Rahmen: 55cm * 45cm.
Signiert.
Datiert: 2025.
Bildtitel: Calgo Rajo.
Rahmung: Rahmenleiste.
Von klein auf vom Malen begeistert und Schülerin ihres Großvaters, der als Autodidakt im Stile der Münchner Schule malte.
Als selbstständige Künstlerin spezialisiert auch auf Tierportraits, vor allem auf Hundeportrait
Objekt-Nr. 3164
Preis: auf Anfrage Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Höfer Amelie
Amelie Höfer
Geboren: 13.03.1997
Studium: Gymnasium Neufahrn - Schauspielschule München.
Technik: Öl / Karton.
Sichtbarer Bildausschnitt: 23cm * 16,5cm.
Abmessung ohne Rahmen: 24cm * 18cm.
Abmessung mit Rahmen: 29cm * 23cm.
Signiert.
Datiert: 2025.
Bildtitel: Sonniger Herbstwald.
Rahmung: Rahmenleiste.
Von klein auf vom Malen begeistert und Schülerin ihres Großvaters, der als Autodidakt im Stile der Münchner Schule malte.
Als selbstständige Künstlerin spezialisiert auch auf Tierportraits, vor allem auf Hundeportrait
Objekt-Nr. 3163
Preis: 200.- Euro
|
|
|
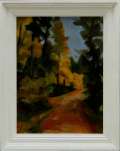 |
|
 |
 |
 |
Höfer Amelie
Amelie Höfer
Geboren: 13.03.1997
Studium: Gymnasium Neufahrn - Schauspielschule München.
Technik: Öl / Karton.
Sichtbarer Bildausschnitt: 23cm * 16,5cm.
Abmessung ohne Rahmen: 24cm * 18cm.
Abmessung mit Rahmen: 29cm * 23cm.
Signiert.
Datiert: 2025.
Bildtitel: Zarte Waldpilze.
Rahmung: Rahmenleiste.
Von klein auf vom Malen begeistert und Schülerin ihres Großvaters, der als Autodidakt im Stile der Münchner Schule malte.
Als selbstständige Künstlerin spezialisiert auch auf Tierportraits, vor allem auf Hundeportrait
Objekt-Nr. 3162
Preis: 220.- Euro
|
|
|
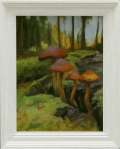 |
|
 |
 |
 |
Höfer Amelie
Amelie Höfer
Geboren: 13.03.1997
Studium: Gymnasium Neufahrn - Schauspielschule München.
Technik: Öl / Karton.
Sichtbarer Bildausschnitt: 18,5cm*23,5cm.
Abmessung ohne Rahmen: 19,5cm * 25cm.
Abmessung mit Rahmen: 25cm * 30cm.
Signiert.
Datiert: 2025.
Bildtitel: Gewitterstimmung über Jetzendorf.
Rahmung: Rahmenleiste.
Von klein auf vom Malen begeistert und Schülerin ihres Großvaters, der als Autodidakt im Stile der Münchner Schule malte.
Als selbstständige Künstlerin spezialisiert auch auf Tierportraits, vor allem auf Hundeportraits.
Objekt-Nr. 3161
Preis: 260.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
unleserlich signiert
Technik: Öl / Karton.
Abmessung ohne Rahmen: 30cm * 40cm.
Abmessung mit Rahmen: 32cm * 42cm.
Signiert unleserlich.
Datiert: 68.
Bildtitel: Stillleben.
Rahmung: Rahmenleiste.
Objekt-Nr. 3160
Preis: 350.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Steinmetz Beppo
Beppo Steinmetz
01.01.1872 in München - 1933 in München.
Studium: Carl von Marr - Ludwig Schmid Reutte - Friedrich Fehr.
Technik: Öl / Leinwand / Holz.
Abmessung ohne Rahmen: 59cm * 49cm.
Abmessung mit Rahmen: 76cm * 66cm.
Signiert.
Bildtitel: Mutter und Tochter.
Rahmung: Rahmen handgefertigt.
Beppo Steinmetz, Sohn eines Hoftapezierers, studierte bei Carl von Marr an der Münchner Akademie der Bildenden Künste sowie bei Ludwig Schmid-Reutte und Friedrich Fehr in Karlsruhe.
1895 und 1896 machte er Studienreisen nach Paris.
1906 nahm er Unterricht an der dortigen Akademie bei Alfred Julien.
Er war Mitglied der Luitpoldgruppe und des Münchner Kunstvereins.
1913 stellte er auf der XI. Internationalen Kunstausstellung im Münchner Glaspalast aus.
Steinmetz`Malweise ist hinsichtlich der Farbbehandlung, der Lichtverteilung und seiner Thematik vom Impressionismus beeinflußt.
Titel wie "Am Tennisplatz", "Im Kurpark", oder das auch durch ihn aufgegriffene und durch Edouard Manet so bekannt gewordene Motiv des "Picknick im Grünen" zeigen seine Vorliebe für Themen aus der Welt des Mondänen.
Darüber hinaus spürt man bei Steinmetz den Willen zu strenger Flächenkomposition beziehungsweise klarer Tektonik innerhalb eines Bildes.
Unter den vom Künstler geschaffenen Portraits ragt "Die Dame im Schleier" heraus, unter den von ihm gestalteten Münchner Szenen das "Karussell am Chinesischen Turm".
Objekt-Nr. 3158
Preis: 1650.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
POINT von HERRMANN (Günther Herrmann) 1950 Tegernsee
HERRMANN von POINT (Günther Herrmann)
1950 Tegernsee.
Technik: Öl / Karton.
Abmessung ohne Rahmen: 47cm * 38cm.
Abmessung mit Rahmen: 58cm * 50cm.
Monogrammiert.
Bildtitel: Stillleben.
Rahmung: Rahmenleiste.
Er absolvierte eine Ausbildung als Kirchenmaler
und schuf schon früh seine Basis durch die perfekte Lasurmalerei.
Seine großartige Technik, sowie die Wahl seiner Farben,
seiner Farbkraft, machen seine Werke einzigartig.
Objekt-Nr. 3157
Preis: 500.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Vukmanovic Stevan
Stevan Vukmanovic
14.08.1924 in Belgrad - 06.01.1995 in Biberach.
Studium: Charles Crodel.
Technik: Öl / Holz.
Abmessung ohne Rahmen: 39,5cm * 30cm.
Abmessung mit Rahmen: 47cm * 37cm.
Signiert.
Bildtitel: Schwabinger Ansicht.
Rahmung: Rahmenleiste.
Frühe Arbeit.
1955 - 61 Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München, Meisterschüler bei Prof. Charles Crodel.
1957 Stipendium vom Bayerischen Staat bzw. vom DAAD (Deutscher Akademie Austauschdienst).
Ausstellungen im Haus der Kunst München mit der Secession.
Objekt-Nr. 3156
Preis: 380.- Euro
|
|
|
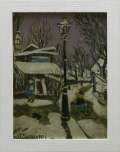 |
|
 |
 |
 |
Krille Jean
Jean Krille
13.07.1923 in Winterthur - 09.02.1991 in Mont-sur-Rolle.
Studium: Bildende Künste in Zürich.
Technik: Öl / Karton.
Abmessung ohne Rahmen: 60cm * 80cm.
Abmessung mit Rahmen: 73cm * 92cm.
Signiert.
Bildtitel: Landschaft.
Rahmung: Rahmenleiste.
Im Alter von 16 Jahren war er an der Hochschule für Bildende Künste in Zürich eingeschrieben, und an der Hochschule für Kunst und Gewerbe in Vevey.
Ein Jahr später findet bereits seine erste Ausstellung statt. 1945 geht er für fünf Jahre nach Paris.
1950 lebt er in London und Richmond.
1953 wird er Partner eines Unternehmens in München, das historische Gebäude renoviert.
1955 eröffnet er sein eigenes Architekturbüro in Genf.
Es folgen einige Jahre in Afrika als Maler, Architekt und Reporter.
Hatte Ausstellungen in Genf, Zürich, Bern, Winterthur, Paris, London und in den USA.
Objekt-Nr. 3154
Preis: 600.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Mühlen-Schmid Josefine
Josefine Mühlen-Schmid
1888 Sarching bei Regensburg - 1960 München.
Studium: Ernst Burmester - Hermann Groeber - Hans Hofmann.
Technik: Öl / Leinwand.
Abmessung ohne Rahmen: 50cm * 60cm.
Abmessung mit Rahmen: 66cm * 76cm.
Signiert rückseitig.
Datiert: 1914.
Bildtitel: Boot am Fluss.
Rahmung: Rahmenleiste.
Josefine Mühlen-Schmid studiert 1908-10 an der Kunstgewerbeschule München, danach bis 1912 an der Damen-Akademie des Künstlerinnen-Vereins München bei Ernst Burmester. Teils mehrmonatige Studienreisen in den Jahren 1911-14 führen sie in die Schweiz, nach Österreich, Frankreich, Belgien und Holland. Ihre dort gewonnenen Eindrücke verarbeitet die Künstlerin in Aquarellstudien, die Jahrzehnte später die Grundlage von Gemäldekompositionen bilden. 1915-19 erhält sie Unterricht bei Hermann Groeber und Hans Hofmann, danach arbeitet sie als freie Malerin in Ohlstadt und München. 1920 heiratet sie den aus dem Rheinland stammenden Maler Hermann Mühlen. Obwohl sie in den darauf folgenden Jahren aufgrund wirtschaftlicher und familiärer Probleme nur wenige Bilder vollenden kann, nimmt die Künstlerin ab 1921 regelmäßig an den jährlichen Ausstellungen im Münchner Glaspalast teil. Sie wird Mitglied der "Juryfreien", später des Künstlerbundes. In den ab Ende der 1920er Jahre entstehenden Bildern reflektiert die Künstlerin ihre neue Rolle als Frau und Mutter; immer wieder porträtiert sie ihren Mann und ihre Kinder in alltäglichen Situationen. 1931 beteiligt sie sich erstmals an einer Gruppenausstellung in Regensburg, nach 1945 ist sie in vielen Münchner Ausstellungen vertreten. In den 1950er Jahren, nach der Trennung von ihrem Mann, entsteht ihr Spätwerk, das fast völlig frei ist von den unmittelbaren künstlerischen Einflüssen der Gegenwart. 1954 nimmt Mühlen-Schmid an der Malerinnen-Biennale in Bozen teil. Zwei Jahre nach ihrem Tod findet eine erste Gedächtnis-Ausstellung statt.
Objekt-Nr. 3151
Preis: 1200.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Achmann Wolfgang
Wolfgang Achmann
Studium: 1982 - 1988 Akademie der Bildenden Künste.
Seit 1998 freischaffender Künstler.
Technik: Lack / Platte.
Abmessung ohne Rahmen: 65cm * 50cm.
Abmessung mit Rahmen:66cm * 51cm.
Signiert rückseitig.
Datiert: 2002.
Bildtitel: Konfetti 1.
Rahmung: Rahmenleiste aus Metall.
Objekt-Nr. 3150
Preis: 200.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Geiseler Hermann
Hermann Geiseler
1903 Hamburg 1975.
Studium: Kunstakademie München bei Adolf Schinnerer.
Technik: Öl / Leinwand / Spannplatte.
Abmessung ohne Rahmen: 47cm * 28,5cm.
Abmessung mit Rahmen: 49cm * 30,5cm.
Signiert.
Bildtitel: Stillleben.
Rahmung: Rahmenleiste.
Der Landschaftsmaler Hermann Geiseler war Schüler von Adolf Schinnerer in München.
Er war von van Gogh und Kokoschka beeinflusst, und gewann 1930 den Dürerpreis der Stadt Nürnberg.
1948 war er mit Peter Paul Althaus (1892-1965) auf Seiten der Literaten Gründungsmitglied des Seerosenkreises in München, eines Stammtisches von bildenden Künstlern und Literaten im Schwabinger Lokal "Seerose" (Ecke Feilitzschstrasse/ Gunezrainerstrasse), der von Ernst Hoferichter einmal als "Treibhaus der Poesie" bezeichnet wurde und der bis zur Lokalschließung 1976 bestand.
Eine Kollektiv-Ausstellung seiner Werke veranstaltete 1952 die Galerie Schöninger, München.
Objekt-Nr. 3140
Preis: 450.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Vornehm Anneliese
Anneliese Vornehm
11. März 1928 in Fürstenstein bei Passau - 02. Mai 2020.
Studium: R.E. Bergmann aus Hamburg
Technik: Öl / Karton.
Abmessung ohne Rahmen: 42cm * 42cm.
Abmessung mit Rahmen: 49cm * 49cm.
Signiert.
Datiert: 54.
Titel: Abendstimmung am Bodensee.
Rahmung: Rahmenleiste.
Ausbildung bei Prof. Bergmann, Hamburg.
Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert von 1868 (Jurymitglied).
Vorstandsmitglied der Deggendorfer Künstlergruppe e. V.
Seit 1969 Mitglied der Gemeinschaft Bildender Künstler Straubing.
Ehrenbürgerbrief der Stadt Deggendorf.
Objekt-Nr. 3119
Preis: 160.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Andok Ludwig von
Ludwig von Andok
11. Januar 1890 in Budapest - 09. April 1981 in Regensburg
Technik: Öl / Karton.
Abmessung ohne Rahmen: 28cm * 43cm.
Abmessung mit Rahmen: 40cm * 56cm.
Signiert.
Bildtitel: Blumenstrauß.
Rahmung: Rahmenleiste
Ludwig von Andok war ein Maler des Postimpressionismus.
Von Andok wuchs bis zu seinem achten Lebensjahr in Regensburg auf, besuchte von 1900 bis 1906 das angesehene humanistische Gymnasium Leopoldinum in Passau.
Dem guten Schüler, der forschender Arzt werden wollte, wurden als gebürtigem Ungar im Zuge des wachsenden deutschen Nationalismus ab 1904, einhergehend mit dem Kolonialismus, die historischen Verbrechen der Hunnen als deren Nachfahre persönlich angelastet. Nach hieraus resultierenden gewalttätigen Nachsetzungen durch Mitschüler verließ von Andok vorzeitig das Gymnasium, womit ihm auch der Arztberuf verwehrt war. Dennoch blieb der gleichwertige heiße Wunsch, Maler zu werden.
Eine 15 Jahre währende Beamtenkarriere bei der Donau-Dampfschiffahrt-Gesellschaft (DDSG) in der Agentie Passau hinderte von Andok daran, sich vorwiegend der Malerei widmen zu können. Familiäre, berufliche und gesundheitliche Umstände erlaubten die Verwirklichung erst ab 1925 in Regensburg.
Auf rund 1000 Gemälden hat der Künstler Alpenmotive, später vor allem die Oberpfalz in Airplein- und alla prima-Manier auf die Leinwand gebannt. Der pastose Farbauftrag mit teilweiser Spachteltechnik lässt manch ein Bild mit sich veränderndem Tageslicht in ganz verschiedenen Stimmungen erscheinen – morgens liegt Nebel über den Voralpen, mittags schmilzt die Sonne den Schnee in Felswänden, abends zieht nach einem schwülen Sommertag ein Gewitter auf. Mit seinen Motiven und seiner Maltechnik steht von Andok in der Tradition deutscher Impressionisten wie Max Liebermann, Lovis Corinth oder Max Slevogt.
Außer den Landschaften in zarten Oliv- und Blaugrautönen, sparsam durchsetzt von Erdtönen, gibt es auch Blumenstillleben von Andoks. Nur selten sind sie mittig platziert, stehen seitlich, drohen mitunter von ihrer Unterlage zu stürzen. Mal liegen überreife Samenkörner, mal welkende Blütenblätter auf dem Tisch; jede Pflanze ist in ihrem Werden und Vergehen porträtiert.
Der schriftliche Nachlass des Künstlers, der auch schriftstellerisch tätig war, besteht aus Dutzenden Zeitzeugenberichten und Hunderten Archivmaterialien, die den Grundstock zur ersten Biografie bildeten.
Objekt-Nr. 3116
Preis: 250.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Finster Herbert
Herbert Finster
26. August 1930 in Prien / Chiemsee - 03. März 2000.
Studium: Studien bei Henri Matisse, Franz Xaver Fuhr und Max Wendel.
Technik: Öl / Leinwand.
Abmessung ohne Rahmen: 60cm * 50cm.
Abmessung mit Rahmen: 76cm * 66cm.
Signiert.
Datiert: 96.
Bildtitel: "Blauer Strauß".
Rahmung: Handgefertigter Künstlerrahmen von Herbert Finster.
Am 26. August 1930 wird Herbert Finster in Prien am Chiemsee geboren.
1947 - 1950 Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Prof. Hans Götz.
1948 Erste Ausstellung im Louvre in Paris.
1948-1951 Studien bei Henri Matisse, Franz Xaver Fuhr und Max Wendel.
1950 Erste Studienreise Südfrankreich – Nizza.
1966 Anerkennungspreis seiner Heimatgemeinde Prien.
1966 Studienreise nach Frankreich.
1968 Gründungsmitglied „Kunstkreis 68“ in Wasserburg a.Inn.
1969 Studienreise nach Thailand und Kambodscha.
1978 Aufnahme und Eintrag in „Who is Who in the Arts”.
1978 H.F. gestaltet sein Haus als Ateliergalerie. Seine Hausausstellungen finden jährlich statt und machen Furore.
Viele prominente Freunde finden sich in gemütlichen Diskussionsrunden ein.
1979 Verleihung des Kunstpreises von Italien.
1980 Verleihung der Professur der Kunstakademie Parma / Italien.
1980 Euromedaille in Gold des Europäischen Kulturkreises Baden Baden.
1980 Höchstes Happening der Welt: 2 Miniaturbilder werden von Bergsteiger Kurt Diemberger auf dem Mount Everest zur höchsten Ausstellung deponiert.
1985 Veröffentlichung seines ersten Buches „Herbert Finster“.
1986 Verleihung des Titels Doktor h.c. in Kunst der “Unifersidad de Ciencias Humanisticas” Buenos Aires / Argentinien.
1987 Verleihung des Titels Doktor h. c. in Kunst der “Interamerican University of Humanistic Studies” - Study and Research Center of Nations Florida - USA.
1988 Veröffentlichung seines zweiten Buches „Finster`s St(r)icheleien.
1993 Nach einer Herzattacke signiert H.F. nun alle seine Bilder mit ivsp ( in vita secunda pinxit) - im zweiten Leben gemalt-.
1998 Begründung und Wegbereitung des Mentalismus i.d.M.
Gestorben am 03. März 2000 in seiner Heimat Bayern.
Objekt-Nr. 3115
Preis: 650.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Finster Herbert
Herbert Finster
26. August 1930 Prien / Chiemsee - 03. März 2000.
Studium: Studien bei Henri Matisse, Franz Xaver Fuhr und Max Wendel.
Technik: Öl / Leinwand.
Abmessung ohne Rahmen: 30cm * 24cm.
Abmessung mit Rahmen: 40cm * 34cm.
Signiert.
Datiert: 93.
Bildtitel: Durchblick.
Rahmung: Handgefertigter Künstlerahmen von Herbert Finster.
Am 26. August 1930 wird Herbert Finster in Prien am Chiemsee geboren.
1947 - 1950 Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Prof. Hans Götz.
1948 Erste Ausstellung im Louvre in Paris.
1948-1951 Studien bei Henri Matisse, Franz Xaver Fuhr und Max Wendel.
1950 Erste Studienreise Südfrankreich – Nizza.
1966 Anerkennungspreis seiner Heimatgemeinde Prien.
1966 Studienreise nach Frankreich.
1968 Gründungsmitglied „Kunstkreis 68“ in Wasserburg a.Inn.
1969 Studienreise nach Thailand und Kambodscha.
1978 Aufnahme und Eintrag in „Who is Who in the Arts”.
1978 H.F. gestaltet sein Haus als Ateliergalerie. Seine Hausausstellungen finden jährlich statt und machen Furore.
Viele prominente Freunde finden sich in gemütlichen Diskussionsrunden ein.
1979 Verleihung des Kunstpreises von Italien.
1980 Verleihung der Professur der Kunstakademie Parma / Italien.
1980 Euromedaille in Gold des Europäischen Kulturkreises Baden Baden.
1980 Höchstes Happening der Welt: 2 Miniaturbilder werden von Bergsteiger Kurt Diemberger auf dem Mount Everest zur höchsten Ausstellung deponiert.
1985 Veröffentlichung seines ersten Buches „Herbert Finster“.
1986 Verleihung des Titels Doktor h.c. in Kunst der “Unifersidad de Ciencias Humanisticas” Buenos Aires / Argentinien.
1987 Verleihung des Titels Doktor h. c. in Kunst der “Interamerican University of Humanistic Studies” - Study and Research Center of Nations Florida - USA.
1988 Veröffentlichung seines zweiten Buches „Finster`s St(r)icheleien.
1993 Nach einer Herzattacke signiert H.F. nun alle seine Bilder mit ivsp ( in vita secunda pinxit) - im zweiten Leben gemalt-.
1998 Begründung und Wegbereitung des Mentalismus i.d.M.
Gestorben am 03. März 2000 in seiner Heimat Bayern.
Objekt-Nr. 3114
Preis: 500.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Nemeth Miklos
Miklos Nemeth
1934 in Budapest - 2012 in Budapest.
Studium: Freie Kunstschule Budapest.
Technik: Öl / Karton.
Abmessung ohne Rahmen: 70cm * 46cm.
Abmessung mit Rahmen: 76cm * 53cm.
Signiert.
Rückseitig Nachlassstempel.
Bildtitel: Akte.
Rahmung: Rahmenleiste.
Zwischen 1950 und 1954 absolvierte er ein Studium an der freien Kunstschule von Ödön Márffy (1878-1959), die den Prinzipien der Pariser Académie Julian, wo auch Marffy studierte, folgte.
Frühe Bekanntschaften und Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern wie István Szönyi, Oszkár Glatz, János Kmetty und Tóth Menyhért befruchteten sein künstlerisches Leben.
Von 1957 bis 1980 arbeitetet er in verschiedenen Künstlerkolonien in Ungarn.
Németh nahm an internationalen Ausstellungen teil wie 1971 in Moskau, 1973 in Dresden und 1975 in Brünn. Seit 1981 war er eingetragener Künstler und wurde 1992 zum Mitglied der Vereinigung ungarischer Maler gewählt.
Némeths wichtigste Einzelausstellungen waren 1981 in der Kunsthalle Budapest, im Jahre 2000 im Ernst-Museum.
Bereits in jungen Jahren entwickelte sich Némeths eigener Stil. Charakteristisch für seinen leidenschaftlich-dynamischen Umgang mit dem Pinsel ist einerseits seine subjektive, heftige Farbwahl, andererseits seine impulsive Arbeitsweise, d. h. er fertigte keine Malstudien und spätere Korrekturen oder Serien sich entwickelnder Bilder an. Unter Ablehnung des sozialistischen Realismus orientierte sich Németh an westlichen Stilrichtungen und wählte für seine Arbeiten eine objektive Darstellungsart der von ihm bevorzugten Themen wie die Natur, urbane Landschaften, der arbeitende Mensch, der weibliche Körper sowie Portraits. Seine Motive fand er im Garten seiner Villa auf der Buda-Seite mit Blick auf die Berge. Besonders gern war er mit seiner Staffelei in der freien Natur unterwegs, malte Brücken, Berge und die Donau. In seinen Bildern spiegeln sich immer seine pantheistische Sichtweise sowie sein koloristisches Wesen wider. Als ein schon zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn von inneren Bildern geleiteter und von den Farben sich abkühlender Lava inspirierter Künstler sieht sich Miklós Németh selbst als den „Maler des Vulkans"
Objekt-Nr. 3112
Preis: 220.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Nemeth Miklos
Miklos Nemeth
1934 in Budapest - 2012 in Budapest.
Studium: Freie Kunstschule Budapest.
Technik: Öl / Karton.
Abmessung ohne Rahmen: 102cm * 72cm.
Abmessung mit Rahmen: 113cm * 84cm.
Signiert.
Datiert: 69.
Rückseitig Nachlasstempel.
Bildtitel: Rennradfahrer.
Rahmung: Rahmenleiste.
Zwischen 1950 und 1954 absolvierte er ein Studium an der freien Kunstschule von Ödön Márffy (1878-1959), die den Prinzipien der Pariser Académie Julian, wo auch Marffy studierte, folgte.
Frühe Bekanntschaften und Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern wie István Szönyi, Oszkár Glatz, János Kmetty und Tóth Menyhért befruchteten sein künstlerisches Leben.
Von 1957 bis 1980 arbeitetet er in verschiedenen Künstlerkolonien in Ungarn.
Németh nahm an internationalen Ausstellungen teil wie 1971 in Moskau, 1973 in Dresden und 1975 in Brünn. Seit 1981 war er eingetragener Künstler und wurde 1992 zum Mitglied der Vereinigung ungarischer Maler gewählt.
Némeths wichtigste Einzelausstellungen waren 1981 in der Kunsthalle Budapest, im Jahre 2000 im Ernst-Museum.
Bereits in jungen Jahren entwickelte sich Némeths eigener Stil. Charakteristisch für seinen leidenschaftlich-dynamischen Umgang mit dem Pinsel ist einerseits seine subjektive, heftige Farbwahl, andererseits seine impulsive Arbeitsweise, d. h. er fertigte keine Malstudien und spätere Korrekturen oder Serien sich entwickelnder Bilder an. Unter Ablehnung des sozialistischen Realismus orientierte sich Németh an westlichen Stilrichtungen und wählte für seine Arbeiten eine objektive Darstellungsart der von ihm bevorzugten Themen wie die Natur, urbane Landschaften, der arbeitende Mensch, der weibliche Körper sowie Portraits. Seine Motive fand er im Garten seiner Villa auf der Buda-Seite mit Blick auf die Berge. Besonders gern war er mit seiner Staffelei in der freien Natur unterwegs, malte Brücken, Berge und die Donau. In seinen Bildern spiegeln sich immer seine pantheistische Sichtweise sowie sein koloristisches Wesen wider. Als ein schon zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn von inneren Bildern geleiteter und von den Farben sich abkühlender Lava inspirierter Künstler sieht sich Miklós Németh selbst als den „Maler des Vulkans"
Objekt-Nr. 3109
Preis: 500.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |