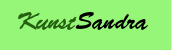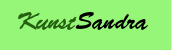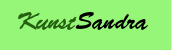
Startseite
Künstlerindex
GemäldeAquarelleGrafik - Collage - Mischt.BronzenGlasKeramik / MarmorPorzellanVaria Kontakt
Impressum / AGB

|
 |
|
Grafik - Collage - Mischt.
Seite: 1 [2] 3 4
Riessland Walter
Walter Riessland
Technik: Tempera / Papier.
Sichtbarer Blattausschnitt: 44cm * 62cm.
Abmessung mit Rahmen: 67cm * 85cm.
Signiert.
Bildtitel: Landschaft.
Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.
Objekt-Nr. 2997
Preis: 120.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Bearach Dorit
Dorit Bearach
02. August 1958 in Tel Aviv.
Studium: 1980-85 Hochschule für Bildende Künste Dresden
Technik: Mischtechnik / Papier.
Sichtbarer Blattausschnitt: 32cm * 34cm.
Abmessung mit Rahmen: 61cm * 51cm.
Signiert.
Datiert: 94.
Bildtitel: Person.
Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.
Dorit Bearach wurde 1958 im israelischen Tel Aviv geboren. Sie kam 1980 nach Dresden und studierte an der dort ansässigen Hochschule für Bildende Künste bei Günter Horlbeck und Siegfried Klotz Malerei und Graphik. 1985 schloss sie ihr Studium ab. Seither arbeitet sie als freischaffende Künstlerin und Kuratorin in Berlin.
Dorit Bearach war Stipendiatin des Kantons Graubünden in der Schweiz (2003) und Gast beim International Terracottasymposium 2011, sowie dem 9th International Art Workshop (2018) in Eskisehir / Türkei. 2005 erhielt sie den Brandenburgischen Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung, 2019 den „Hans und Lea Grundig Preis“ der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Ihre Werke befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen u. a. Kupferstichkabinett Berlin, Brandenburgisches Landesmuseum für Moderne Kunst (BLMK), Kulturstiftung Rügen, Potsdam Museum, Berliner Senat und Sammlung Meitlis, Tel Aviv.
Objekt-Nr. 2995
Preis: 150.- Euro
|
|
|
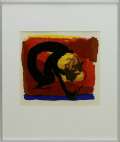 |
|
 |
 |
 |
Heckendorf Franz
Franz Heckendorf
05. November 1888 in Schöneberg - 17. August 1962 in München.
Studium: Berliner Akademie der Künste.
Technik: Pastell / Papier - Tapete.
Sichtbarer Blattausschnitt: 33cm * 50cm.
Abmessung mit Rahmen: 52cm * 62cm.
Signiert.
Bildtitel: Landschaft.
Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.
Franz Heckendorf ist Sohn eines Architekten. Mit 15 Jahren verließ er das Gymnasium und absolvierte eine Lehre als Dekorationsmaler. Ab 1905 bis 1908 studierte er an der Berliner Kunstgewerbeschule und an der Berliner Akademie der Künste.
1909 stellte er zwei impressionistisch geprägte Straßenbilder in der Berliner Sezession aus. Während seines Einsatzes im Ersten Weltkrieg als Kampfflieger an der Ostfront, Balkan, Bosporus und im heutigen Irak am Tigris wandte er sich immer mehr dem Expressionismus zu. Auch versuchte er seine Kriegseindrücke in Gemälden, wie z. B. Vormarsch deutscher Truppen an der Morawa (1916) künstlerisch zu verarbeiten.
1917 trat er dem Deutschen Künstlerbund bei. Von 1916 bis 1918 gehörte er dem Vorstand und der Jury der Berliner Sezession an. In seinen expressionistischen Werken betonte Heckendorf im dynamischen Malstil besonders die Ausdruckskraft von teilweise harten Konturen und kräftigen, leuchtenden Farben. Er malte sowohl Ölgemälde, wie auch Pastelle und Aquarelle, in denen er Bildnisse und Figürliches ebenso wie Landschaften und Stillleben darstellte.
Eine umfangreiche Sonderausstellung in der Kestner-Gesellschaft in Hannover im Frühsommer 1918 gab einen Überblick über die erste Schaffensperiode des jungen Künstlers seit 1912.
Während der Weimarer Republik, deren überzeugter Anhänger er war, galt Heckendorf als „Maler der Republik“ und „Liebling der sogenannten Gesellschaft“, seine Bilder fanden Eingang in die Sammlungen prominenter demokratischer Politiker wie Matthias Erzberger und Walther Rathenau, und eines seiner Gemälde der Verfassungsfeier vor dem Berliner Reichstag von 1929 wurde vom Reichskanzler angekauft.
Heckendorf trat 1936 der Reichskammer der Bildenden Künste bei, wurde 1940 jedoch ausgeschlossen[6]. Von 1939 bis 1943 wohnte er abwechselnd in Berlin und Kitzbühel.
1937 wurde in der Nazi-Aktion „Entartete Kunst“ Werke Heckendorfs aus dem Stadtbesitz von Berlin, der Nationalgalerie (Kronprinzen-Palais) Berlin, der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau, dem Museum Folkwang Essen, dem Kestner-Museum Hannover und dem Kaiser-Friedrich-Museum Magdeburg beschlagnahmt.
Am 24. Februar 1943 wurde Heckendorf verhaftet und ins Landgerichtsgefängnis Waldshut eingeliefert. Am 27. Mai 1943 wurde gegen ihn und drei weitere in „Schutzhaft“ genommene Deutsche ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Sie wurden beschuldigt, von der Deportation in Vernichtungslager bedrohten Berliner Juden bei der Flucht in die Schweiz geholfen zu haben. Am 22. März 1944 wurden sie nach zweitägiger Verhandlung von einem Sondergericht in Freiburg zu mehrjährigen Zuchthausstrafen verurteilt. Heckendorf, für den der Staatsanwalt die Todesstrafe gefordert hatte, erhielt mit zehn Jahren die höchste Strafe. Das Gericht beurteilte die Straftaten der Angeklagten zwar als „recht schwerwiegend“ weil sie „sich vorsätzlich ... auf die Seite unserer Feinde gestellt und zum Wohl des Reiches geplante Maßnahmen der Regierung im Krieg zu sabotieren unternommen“ hätten, ging jedoch zur Entlastung der vier nicht-jüdischen Angeklagten davon aus, dass „der ‚Judenschmuggel‘ von einer weit verzweigten Gruppe von Juden, die sich geschickt im Hintergrund hielt, aufgebaut und betrieben worden sein muss. Am 14. April 1944 wurden die vier Verurteilten ins Zuchthaus Ensisheim im Elsass verlegt, wo Heckendorf Schwerstarbeit in den Kaliminen leisten musste. Nachdem er in die Krankenstation des Zuchthauses eingeliefert worden war, erreichte eine dort tätige Pflegerin, dass er die Zuchthauskirche renovieren und mit Wandmalereien versehen konnte. Am 17. September 1944 wurde Heckendorf zuerst ins Zuchthaus nach Ludwigsburg verlegt und von dort ins Arbeitshaus Kaltenstein bei Vaihingen/Enz gebracht, von wo er im April 1945 nach Ulm ins Gefängnis transportiert wurde. Dort wurde er der Gestapo übergeben, die ihn Ende April 1945 noch ins KZ Mauthausen einweisen ließ, wo er im Mai 1945 von den US-Truppen befreit wurde.
Nach dem Krieg wirkte Heckendorf erst an der Akademie der bildenden Künste Wien und dann in Salzburg. Er arbeitete bis zu seinem Tod am 17. August 1962 in München.
Heckendorfs Malerei wurde ursprünglich vom Expressionismus, insbesondere von Ernst Ludwig Kirchner und Erich Heckel, geprägt. Seine meist landschaftlichen Motive sowie Blumenstilleben sind von einer kräftigen, leuchtenden Farbigkeit. Kunsthistorisch ist er der Verschollenen Generation und dem Expressiven Realismus zuzurechnen. Nach seinem Tod geriet Heckendorf sowohl als Maler wie als Judenretter weitgehend in Vergessenheit. Seine Werke befinden sich u. a. im Lindenau-Museum Altenburg, in der Berlinischen Galerie und im Bröhan-Museum Berlin, im Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg, der Stiftung Moritzburg in Halle, im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg, im Salzburg Museum und im Kunstmuseum Solingen in Solingen-Gräfrath.
Objekt-Nr. 2978
Preis: 550.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Mader Karl
Karl Mader
1926 in Englburg - 12.06.2004 in Tittling.
Technik: Litho / Papier.
Abmessung ohne Rahmen: 38cm * 57cm.
Abmessung mit Rahmen: 62cm * 78cm.
Signiert.
Bildtitel: "Ein Sauhaufen"
Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.
Karl Mader wuchs in einer Steinmetzfamilie auf. Nachdem er im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden war (Verwundung und Gefangenschaft), absolvierte er eine Zimmererlehre und arbeitete zunächst in diesem Beruf. Danach gestaltete er als Steinbildhauer bei der Firma Thiele (Fürstenstein) Skulpturen. Auch in seiner Freizeit war Mader künstlerisch aktiv (Unterstützung und Anregung durch Heinz Theuerjahr sowie Wilhelm Niedermayer; Abendkurse und Fernstudium). In der Mitte der 1960er Jahre wurde er freischaffender Künstler, 1966 war er Mitbegründer des Bayerwaldkreises. Diesen verließ er 1990.
Objekt-Nr. 2963
Preis: 150.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
monogrammiert
monogrammiert
Technik: Tusche / Papier.
Abmessung ohne Rahmen: 34cm * 27cm.
Abmessung mit Rahmen: 45cm * 38cm.
Monogrammiert.
Datiert: 1947.
Bildtitel: Surreale Darstellung.
Rahmung: Rahmenleiste.
Objekt-Nr. 2959
Preis: 250 Euro
|
|
|
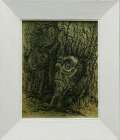 |
|
 |
 |
 |
Vornehm Anneliese
Anneliese Vornehm
11. März 1928 in Fürstenstein bei Passau - 02. Mai 2020.
Studium: R.E. Bergmann aus Hamburg
Technik: Ölmischtechnik / Papier.
Sichtbarer Blattausschnitt: 62cm * 52cm.
Abmessung mit Rahmen: 81cm * 71cm.
Signiert.
Rückseitig datiert: 93.
Titel: Junge Frau mit Hortensie.
Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.
Ausbildung bei Prof. Bergmann, Hamburg.
Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert von 1868 (Jurymitglied).
Vorstandsmitglied der Deggendorfer Künstlergruppe e. V.
Seit 1969 Mitglied der Gemeinschaft Bildender Künstler Straubing.
Ehrenbürgerbrief der Stadt Deggendorf.
Objekt-Nr. 2924
Preis: 250.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Büger Ika
Ika Büger
21.08.1916 in Moskau - 02.01.2007 in München.
Studium: Sommerakademie Kokoschka in Salzburg.
Technik: Mischtechnik / Papier.
Sichtbarer Blattausschnitt: 33cm * 47cm.
Blattgröße: 35cm * 49cm.
Abmessung mit Passepartout: 50cm * 70cm.
Signiert mit Ika Büger Mergel (Mädchenname).
Datiert: 1967.
Bildtitel: Venedig mit Gondeln.
1940 bis 1945 Studium an den Kunstakademien Berlin und Wien.
1954 Sommerakademie Kokoschka, Salzburg.
1949 bis 1955 Ausstellungen in Salzburg, Linz und Wien.
1955 Wohnsitz in München.
1957 Heirat mit Adolf Büger.
1957 Ausstellung mit Adolf Büger in der Galerie Malura, München.
1957 bis 1979 Teilnahme an Ausstellungen im Berufsverband Bildender Künstler in München: Gedokausstellungen in München, Rom, Beirut, in der Künstlergilde in Eßlingen und Regensburg, ferner in Bad Füssing und Passau.
Alljährliche Beteiligung bei der alten priv. Künstlergenossenschaft von 1868 im Haus der Kunst in München.
1969 Ausstellung in Monte Carlo, Ehrendiplom von Monaco.
1972 Kollektivausstellung im Berufsverband, zusammen mit der Gedächnisausstellung von Adolf Büger.
Ab 1972 Lehrtätigkeit an der Volkshochschule in München für Malen und Zeichnen.
1973 Ausstellung in Griesbach i.R. und Schloß Vornbach bei Passau.
1978 Ausstellung in New York in Gallery Lynn Kottler N.Y
Objekt-Nr. 2881
Preis: 250 Euro
|
|
|
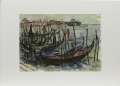 |
|
 |
 |
 |
Bickel-Schultheis Joles
Joles Bickel-Schulteis
14. Dezember 1905 in Frankfurt / Main - 17. Januar 1988 in Ampermoching / Dachau.
Studium: Max Beckmann, Georg Kolbe
Technik: Tempera / Karton.
Abmessung ohne Rahmen: 52cm * 70cm.
Abmessung mit Rahmen: 65cm * 83cm.
Signiert mit Pseudonym E.Löffler.
Bildtitel: Dachauer Moorlandschaft.
Rahmung: Rahmenleiste.
Bickel-Schultheiss, Joles eigentlich Karl Ludwig Bickel, legte sich später den Künstlernamen Joles Bickel-Schultheiss zu.
Studium an der Frankfurter Akademie, Städelsches Institut bei Max Beckmann und Georg Kolbe.
Bickel-Schultheiss pflegte Kontakte zur zeitgenössischen Kunstszene (Max Pechstein, Carl Hofer etc.).
Enttäuscht von den eingeschränkten Lebens- und Schaffensmöglichkeiten während des nationalsozialistischen Regimes verließ er in der Nachkriegszeit Berlin und zog sich zunächst nach Deutenhofen, dann ins Hackermoos zurück. Anschluss an die Gruppe der „Roten Reiter“.
Bickel-Schultheiss malte mit breitem Pinselstich in schneller, expressiver Malweise, meist mit Temperafarben, selten in Öl. Der von Zeitzeugen als hochsensibler Individualist und absoluter Künstler bezeichnete Maler tendierte zu häufigen Übermalungen seiner Bilder, die er oft mit dem Pseudonym „Troffac“ oder " Löffler" signierte, da er seine Unterschrift für nicht wichtig hielt.
Objekt-Nr. 2868
Preis: 220 Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Brown James
James Brown
11. September 1951 in Paris - 22. Februar 2020 in Paris.
Studium: École nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris.
Technik: Mischtechnik / Papier.
Blattgröße: 105cm * 82cm.
Abmessung mit Rahmen: 127cm * 104cm.
Signiert.
Bildtitel: Kopf.
Rahmung: Rahmenleiste mit Plexiglas.
James Brown (* 11. September 1951 in Paris; † 22. Februar 2020 ebenda) war ein US-amerikanischer Maler, der in Paris und Oaxaca tätig war. In den 1980er Jahren war er vor allem für seine rauen, malerischen, halbfigurativen Gemälde bekannt, die Affinitäten zu Jean-Michel Basquiat und der damaligen East Village-Malerei aufwiesen, aber mit Einflüssen aus der primitiven Kunst und der klassischen westlichen Moderne.
Er erhielt einen BFA vom Immaculate Heart College in Hollywood. Danach verbrachte er Jahre in Paris und besuchte die École nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris, Frankreich. Er rebellierte gegen die dortige klassische Ausbildung, die er für irrelevant hielt, blieb aber, da er in Paris bleiben wollte. Reisen durch Europa, bei denen er die Malerei der Renaissance und vor allem des Mittelalters Italiens sah, beeinflussten sein Werk. In den 1980er Jahren entstanden seine Gemälde, die die modernistische Tradition der malerischen Anwendung und des Festhaltens an der Bildoberfläche mit deutlichen Einflüssen aus der Stammeskunst vermischten. In den frühen 1980er Jahren begann er, in New York auszustellen, und in diesem Jahrzehnt wurde dieses Werk zu einem Hit in den Galerien und in der Kunstpresse, da es einen Blick auf die schlechte Malerei und den jungen Neo-Expressionismus der damaligen Maler im East Village hatte. Am 12. September 1987 heiratete er Alexandra Condon, die zu dieser Zeit Kunstgeschichte an der NYU studierte. Sie kannten sich seit etwas mehr als zehn Jahren. Trotz einiger Zeit an der Ost- und Westküste New Yorks lebte er weiterhin in Paris. Mit dem Verschwinden der Kunstszene im East Village hatte er zunehmend in europäischen Galerien ausgestellt, wo seine Arbeiten nun im Kontext einer europäischen Nachkriegsmoderne in der Tradition von Jean Dubuffet gesehen wurden. James und Alexandra bekamen ihr erstes Kind, Degenhart Maria Grey Brown, am 24. September 1989 in New York. 1991 wurde ihr zweiter Junge, Cosmas And Damian Maria Todosantos Brown, am 6. Juni in Paris geboren. Am 16. April 1993 wurde ihre Tochter, Dagmar Maria Jane Brown, in New York geboren. 1995 zog er mit seiner Familie ins Tal von Oaxaca (Mexiko), wo sie neun Jahre lang auf einer Hacienda lebten. Während dieser Zeit stellte James Brown weiterhin in Europa, den Vereinigten Staaten und Mexiko aus. Er und seine Frau arbeiteten mit verschiedenen Künstlern zusammen und stellten in einem Dorf in den Bergen von Oaxaca Teppiche her. Die Teppiche wurden nach traditioneller mexikanischer Art hergestellt und von Hand auf großen Holzrahmen gewebt. James und Alexandra beschlossen dann, Bücher mit Künstlern zu machen, und gründeten Cape Diem Press. Wie die Teppiche werden auch diese Bücher in Oaxaca nach altmodischen und traditionellen Methoden gedruckt. Die Bücher werden in limitierter Auflage gedruckt, und Carpe Diem Press arbeitet weiterhin mit Künstlern zusammen. Im Jahr 2004 zogen sie in die Stadt Mérida in Yucatán. Seitdem verbrachte James Brown viel Zeit in Europa und stellte seine Werke in Frankreich, Deutschland, Italien und Holland aus. Er arbeitete hauptsächlich in Paris.
Seine Arbeit hat im Laufe der Jahre verschiedene Stile angenommen, behält aber einen handgefertigten Look bei, der Anliegen der modernistischen Tradition mit Motiven und spirituellen Interessen aus der Stammeskunst verbindet. Viele seiner Arbeiten sind unrealistisch, enthalten aber Darstellungen oder Zeichen von erkennbaren Gesichtern oder Objekten. In jüngster Zeit hat er mehr in einem abstrakten Modus getan. Der Grat zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion ist bei seinen Arbeiten jedoch oft schwierig, wie zum Beispiel bei seinen jüngeren "Firmament Series" – abstrakte Leinwände, die auch als Verweis auf Sternbilder, Sterne oder Felsgruppen gelesen werden können. Neben der Malerei hat Brown zu verschiedenen Zeitpunkten seiner Karriere auch Skulpturen und Druckserien geschaffen und in den 1990er Jahren begonnen, sich intensiv mit Collagen auseinanderzusetzen. Das Zeichnen und andere einzigartige Arbeiten auf Papier waren wichtig für seine künstlerische Entwicklung und Produktion. In einem Artforum-Rückblick auf eine 25-jährige Retrospektive bemerkte Martha Schwendener: "Die Werke reichen von abstrakten Gouachen über biomorphe und figurative Aquarelle bis hin zu Collagen, die die synthetischen kubistischen Experimente von Picasso und Braque aktualisieren."
Das Paar starb am 22. Februar 2020 bei einem Autounfall in Mexiko.
Objekt-Nr. 2867
Preis: 2500.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
unleserlich signiert
James Brown
11. September 1951 in Paris - 22. Februar 2020 in Paris.
Studium: École nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris.
Technik: Mischtechnik / Papier.
Blattgröße: 105cm * 82cm.
Abmessung mit Rahmen: 127cm * 104cm.
Signiert.
Bildtitel: Kopf.
Rahmung: Rahmenleiste mit Plexiglas.
James Brown (* 11. September 1951 in Paris; † 22. Februar 2020 ebenda) war ein US-amerikanischer Maler, der in Paris und Oaxaca tätig war. In den 1980er Jahren war er vor allem für seine rauen, malerischen, halbfigurativen Gemälde bekannt, die Affinitäten zu Jean-Michel Basquiat und der damaligen East Village-Malerei aufwiesen, aber mit Einflüssen aus der primitiven Kunst und der klassischen westlichen Moderne.
Er erhielt einen BFA vom Immaculate Heart College in Hollywood. Danach verbrachte er Jahre in Paris und besuchte die École nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris, Frankreich. Er rebellierte gegen die dortige klassische Ausbildung, die er für irrelevant hielt, blieb aber, da er in Paris bleiben wollte. Reisen durch Europa, bei denen er die Malerei der Renaissance und vor allem des Mittelalters Italiens sah, beeinflussten sein Werk. In den 1980er Jahren entstanden seine Gemälde, die die modernistische Tradition der malerischen Anwendung und des Festhaltens an der Bildoberfläche mit deutlichen Einflüssen aus der Stammeskunst vermischten. In den frühen 1980er Jahren begann er, in New York auszustellen, und in diesem Jahrzehnt wurde dieses Werk zu einem Hit in den Galerien und in der Kunstpresse, da es einen Blick auf die schlechte Malerei und den jungen Neo-Expressionismus der damaligen Maler im East Village hatte. Am 12. September 1987 heiratete er Alexandra Condon, die zu dieser Zeit Kunstgeschichte an der NYU studierte. Sie kannten sich seit etwas mehr als zehn Jahren. Trotz einiger Zeit an der Ost- und Westküste New Yorks lebte er weiterhin in Paris. Mit dem Verschwinden der Kunstszene im East Village hatte er zunehmend in europäischen Galerien ausgestellt, wo seine Arbeiten nun im Kontext einer europäischen Nachkriegsmoderne in der Tradition von Jean Dubuffet gesehen wurden. James und Alexandra bekamen ihr erstes Kind, Degenhart Maria Grey Brown, am 24. September 1989 in New York. 1991 wurde ihr zweiter Junge, Cosmas And Damian Maria Todosantos Brown, am 6. Juni in Paris geboren. Am 16. April 1993 wurde ihre Tochter, Dagmar Maria Jane Brown, in New York geboren. 1995 zog er mit seiner Familie ins Tal von Oaxaca (Mexiko), wo sie neun Jahre lang auf einer Hacienda lebten. Während dieser Zeit stellte James Brown weiterhin in Europa, den Vereinigten Staaten und Mexiko aus. Er und seine Frau arbeiteten mit verschiedenen Künstlern zusammen und stellten in einem Dorf in den Bergen von Oaxaca Teppiche her. Die Teppiche wurden nach traditioneller mexikanischer Art hergestellt und von Hand auf großen Holzrahmen gewebt. James und Alexandra beschlossen dann, Bücher mit Künstlern zu machen, und gründeten Cape Diem Press. Wie die Teppiche werden auch diese Bücher in Oaxaca nach altmodischen und traditionellen Methoden gedruckt. Die Bücher werden in limitierter Auflage gedruckt, und Carpe Diem Press arbeitet weiterhin mit Künstlern zusammen. Im Jahr 2004 zogen sie in die Stadt Mérida in Yucatán. Seitdem verbrachte James Brown viel Zeit in Europa und stellte seine Werke in Frankreich, Deutschland, Italien und Holland aus. Er arbeitete hauptsächlich in Paris.
Seine Arbeit hat im Laufe der Jahre verschiedene Stile angenommen, behält aber einen handgefertigten Look bei, der Anliegen der modernistischen Tradition mit Motiven und spirituellen Interessen aus der Stammeskunst verbindet. Viele seiner Arbeiten sind unrealistisch, enthalten aber Darstellungen oder Zeichen von erkennbaren Gesichtern oder Objekten. In jüngster Zeit hat er mehr in einem abstrakten Modus getan. Der Grat zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion ist bei seinen Arbeiten jedoch oft schwierig, wie zum Beispiel bei seinen jüngeren "Firmament Series" – abstrakte Leinwände, die auch als Verweis auf Sternbilder, Sterne oder Felsgruppen gelesen werden können. Neben der Malerei hat Brown zu verschiedenen Zeitpunkten seiner Karriere auch Skulpturen und Druckserien geschaffen und in den 1990er Jahren begonnen, sich intensiv mit Collagen auseinanderzusetzen. Das Zeichnen und andere einzigartige Arbeiten auf Papier waren wichtig für seine künstlerische Entwicklung und Produktion. In einem Artforum-Rückblick auf eine 25-jährige Retrospektive bemerkte Martha Schwendener: "Die Werke reichen von abstrakten Gouachen über biomorphe und figurative Aquarelle bis hin zu Collagen, die die synthetischen kubistischen Experimente von Picasso und Braque aktualisieren."
Das Paar starb am 22. Februar 2020 bei einem Autounfall in Mexiko.
Objekt-Nr. 2866
Preis: 2500.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Hegemann
Hegemann
Technik: Mischtechnik / Collage / Papier.
Abmessung ohne Rahmen: 60cm * 42cm.
Abmessung mit Rahmen: 70cm * 51cm.
Signiert: Hegemann.
Datiert: 1973.
Bezeichnet: Paris.
Bildtitel: .
Objekt-Nr. 2865
Preis: 200 Euro
|
|
|
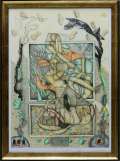 |
|
 |
 |
 |
monogrammiert
monogrammiert
Technik: Pastell / Papier.
Abmessung ohne Rahmen: 28cm * 40cm.
Abmessung mit Rahmen: 49cm * 68cm.
Monogrammiert: LK.
Bildtitel: Landschaft.
Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.
Objekt-Nr. 2864
Preis: 250 Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Liniendruck
Liniendruck
Technik: Druck / Papier.
Abmessung ohne Rahmen: 48cm * 48cm.
Abmessung mit Rahmen: 60cm * 60cm.
Signiert.
Datiert: 71.
Bildtitel: Abstrakt.
Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.
Objekt-Nr. 2862
Preis: 200.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
unleserlich signiert
Technik: Mischtechnik / Papier.
Sichtbarer Blattausschnitt: 20cm * 20cm.
Abmessung mit Rahmen: 49cm * 39cm.
Unleserlich signiert.
Bildtitel: Paracelsus.
Rahmung: Rahmen mit Glas.
Objekt-Nr. 2858
Preis: 150.- Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Richter Gerhard
Gerhard Richter
09. Februar 1932 in Dresden.
Studium: 1961-1963 an der Düsseldorfer Akademie.
Technik: Farboffset.
Abmessung: 15cm * 10,5cm.
Abmessung mit Rahmen: 48cm *40cm.
Signiert.
Bildtitel: 192 Farben.
Rahmung: Handgefertigter Rahmen.
Gerhard Richter ist ein deutscher Maler, Bildhauer und Fotograf.
Er war von 1971 bis 1993 Professor für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf.
Seine Werke zählen auf dem Kunstmarkt zu den teuersten eines lebenden Künstlers.
Objekt-Nr. 2846
Preis: 600 Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Rongstock Hermann
Hermann Rongstock
15. Mai 1941 in Bayreuth - 21. August 2012 in Bayreuth.
Studium: Studium der Gebrauchsgrafik in München.
Technik: Pastell / Papier.
Abmessung ohne Rahmen: 64cm * 49cm.
Abmessung mit Rahmen: 90cm * 72cm.
Signiert.
Titel: Haus am Moorsee.
Rahmung: Rahmen mit Glas.
Hermann Rongstock war ein deutscher Maler, Grafiker, Illustrator und Zeichner. Sein Schaffen ist überwiegend vom Expressionismus und der Wiener Moderne beeinflusst. Eine bedeutende Auswahl seiner Werke ist unter anderem in der Staatlichen Graphischen Sammlung in München sowie im Marbacher Schiller-Nationalmuseum zu sehen. Im Jahr 2006 wurde Hermann Rongstock für sein Schaffen mit dem Kulturpreis der Stadt Bayreuth geehrt.
Die Anfänge seines Lebens beschrieb der Künstler aus eigenen Erinnerungen als dramatisch und hart. Er wuchs als Halbwaise auf und begann zu Schulzeiten u. a. Aktzeichnungen anzufertigen, was ihm das Missfallen seiner Lehrer einbrachte und für frühes Aufsehen sorgte. Da Rongstock in seiner Jugend Bayreuth als beengend und zu klein wahrnahm, entschied er sich, die Stadt frühzeitig zu verlassen. In München absolvierte er in den Jahren 1958–1960 ein Studium der Gebrauchsgrafik an der Blocherer Schule für freie und angewandte Kunst.
Nach Beenden des Studiums der Gebrauchsgrafik in München lernte Rongstock von 1960 bis 1961 als Stipendiat an der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst bei Oskar Kokoschka auf der Festung Hohensalzburg. Dessen „Schule des Sehens“ propagierte die enge Verbindung von künstlerischem Handwerk und intellektueller Bildung zugleich – ein Verständnis, das Rongstock später erkennbar übernahm. Der österreichische Maler und Schriftsteller Oskar Kokoschka kann als wesentlicher Bezugs- und Referenzpunkt im Schaffen Rongstocks angesehen werden. Kokoschkas figurative Kunst mit konkretem Landschafts- und Menschenbild beeinflusste Rongstocks Arbeiten sichtbar; Hermann Rongstock schulte sich auf der Sommerakademie vor allem in Aquarelltechnik. Er absolvierte sein Studium bei Kokoschka mit persönlichem Zeugnis des Meisters.
1961 wieder in München angekommen, begann Rongstock ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste München. In den Folgejahren 1962 bis 1967 entwickelte er sich zum Meisterschüler bei den Professoren Hermann Kaspar und Mac Zimmermann. Illustrationen und Malerei setzten in dieser Zeit den Schwerpunkt seines Schaffens, das er mit Exzellenz und zunehmender Entwicklung eines eigenen Stils vorantrieb. 1968 erhielt Rongstock ein Diplom für besondere künstlerische Leistungen in Malerei und Grafik durch die Akademie.
In den Jahren 1967 bis 1969 studierte Rongstock Psychologie und Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Bamberg (später in der Otto-Friedrich-Universität Bamberg).
1970 kehrte er zurück in seine Geburtsstadt Bayreuth, in der eine avantgardistische Kunstszene entstanden war, initiiert von einer ganzen Reihe „hierhin verschlagener Künstlerpersönlichkeiten […] wie Hannah Barth, Fritz Böhme und Ferdinand Röntgen“. Ausschlaggebend für Rongstocks Rückkehr nach Bayreuth war das kulturelle Umfeld der Stadt Bayreuth: „Richard Wagner, Jean Paul und das schöne Jugendstilhaus, das er von seiner Mutter geerbt hat.“
Nach Rongstocks Kunstverständnis bildete Produktion und Rezeption von Kunst eine Einheit. Kunst zu machen bedeutete ihm: Kunst verstehen, direkt aus der Praxis. Diese Auffassung war auch für seine Arbeit als Kunsterzieher am Wirtschaftswissenschaftlichem und Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasium der Stadt Bayreuth grundlegend.
Objekt-Nr. 2835
Preis: 300 Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
unleserlich signiert
unleserlich signiert
Technik: Mischtechnik - Druck - Büttenpapier.
Blattgröße: 75cm * 57cm.
Abmessung mit Rahmen: 91cm * 71cm.
Signiert.
Nummeriert und datiert: 64 / 95.
Bildtitel: fecundi de - Fruchtbarkeit.
Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.
Objekt-Nr. 2828
Preis: 350 Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
unleserlich signiert
unleserlich signiert
Technik: Mischtechnik - Druck - Büttenpapier.
Blattgröße: 75cm * 57cm.
Abmessung mit Rahmen: 91cm * 71cm.
Signiert.
Nummeriert und datiert: 80 / 95.
Bildtitel: incandescent - Weißglut.
Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.
Objekt-Nr. 2827
Preis: 350 Euro
|
|
|
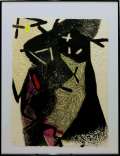 |
|
 |
 |
 |
Bienenstein
Bienenstein
Technik: Druck / Papier.
Abmessung ohne Rahmen: 24cm * 34cm.
Abmessung mit Rahmen: 43cm * 53cm.
Signiert.
Datiert: 67.
Bildtitel: Abstrakt.
Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.
Objekt-Nr. 2825
Preis: 200 Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Thoma Emil
Emil Thoma
26. April 1869 in Enge, jetzt Ortsteil von Zürich - 21. November 1948 in Riedering.
Studium: Kunstakademie München bei Karl Raupp..
Technik: Farbholzschnitt / Papier.
Sichtbarer Blattausschnitt: 29cm * 35cm.
Abmessung mit Rahmen: 59cm * 66cm.
Signiert.
Bildtitel: Heimkehr.
Rahmung: Rahmenleiste mit Glas.
Thoma war der Sohn eines Bankbeamten. Er studierte an der Kunstgewerbeschule und schrieb sich am 20. Oktober 1890 an der Akademie in München ein. Hier war er ein Schüler in der Naturklasse bei Karl Raupp und bei Wilhelm von Diez. Er ließ sich später in Riedering (Chiemgau) nieder. Er fertigte ein Bildnis des Zeichners Karl Hagemeister, zu dem er 1924 eine Abhandlung in der Zeitschrift Die Kunst für alle veröffentlichte. Von ihm stammen auch 60 kunstgewerbliche Entwürfe, die 1896 auf 25 Tafeln abgedruckt wurden. Die Entwürfe spiegeln den Charakter des späten französischen und deutschen Rokokos und waren für eine Ausführung in Holz, Metall oder Porzellan vorgesehen. Thoma war 1938 auf der Großen Deutschen Kunstausstellung in München mit dem Ölgemälde „Feierabend“ vertreten, das Hitler für 2500 RM erwarb.
Thoma war mit der Volksliedpflegerin Annette Thoma (1886–1974) verheiratet.
Objekt-Nr. 2756
Preis: 300 Euro
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
Seite: 1 [2] 3 4
|
|